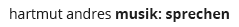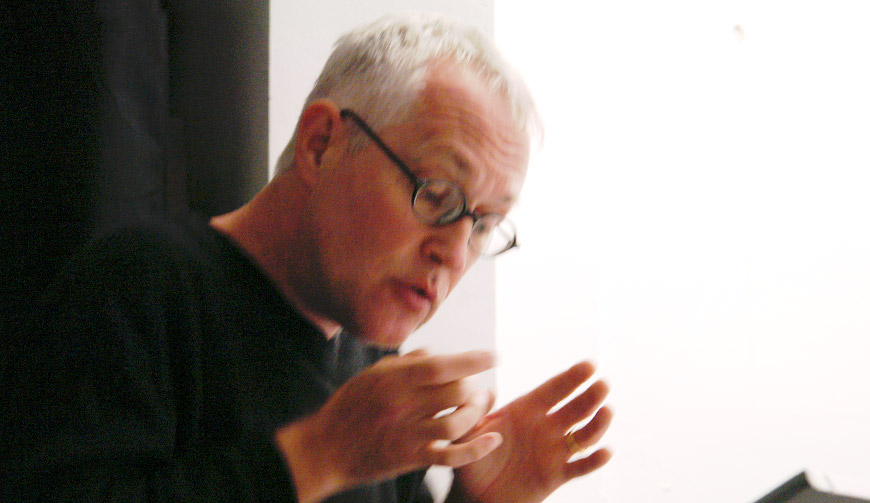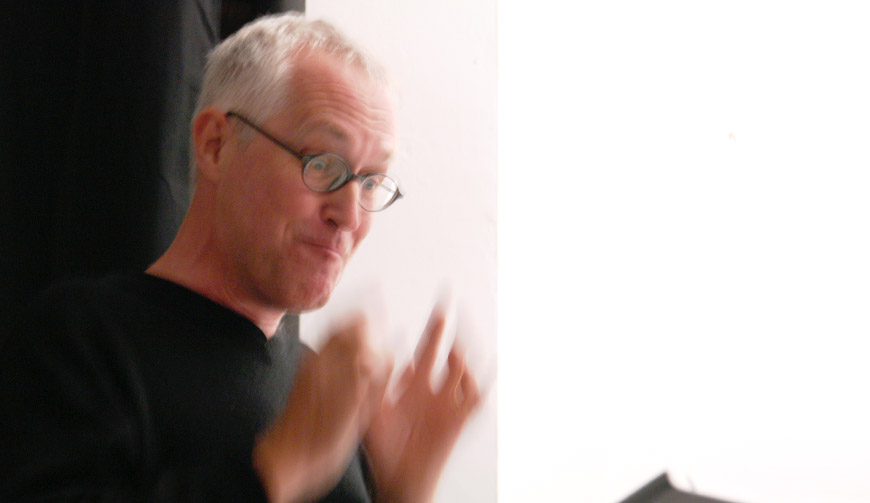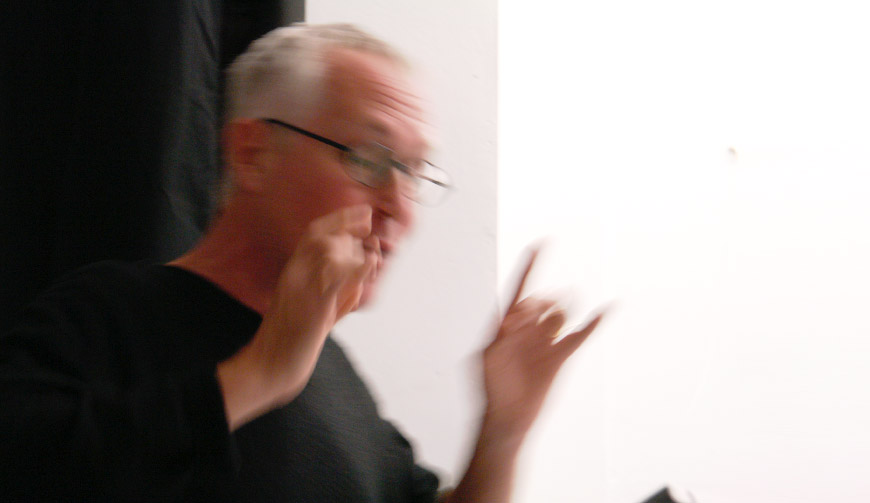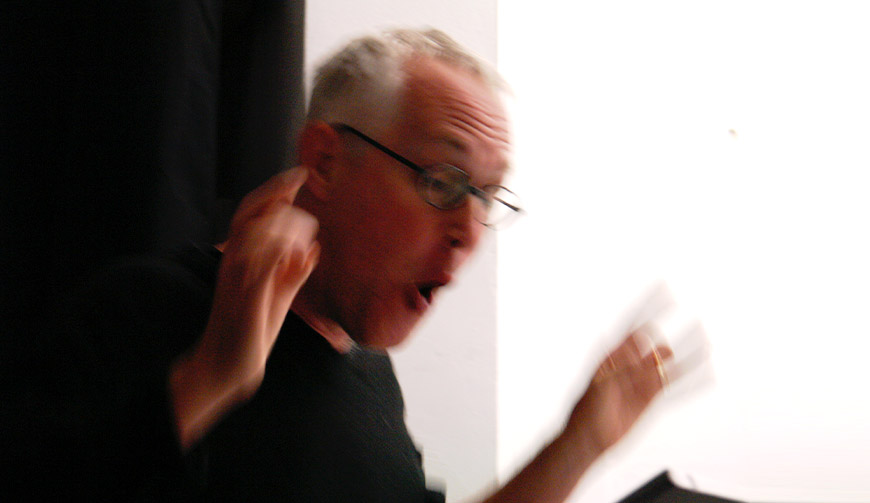musiksprechen
die hier entstehende zitaten-collage versammelt autoren die mich in meiner arbeit nachhaltig geprägt haben und kreist um das „musik sprechen“, um die die begriffe
„wort“ „musik“ „schweigen“ „laut“ „sprache“ „sprechen“ „artikulation“ „klang“ „zeit“
wie würden sie [...] ein musikalisches sprechen, ein „musiksprechen“, [...] definieren? michael hirsch hat den titel „musiksprechen“ [...] gefunden. meine version war „musik sprechen“. musik wird gesprochen, statt musik zum beispiel an der violine ausgeübt oder gespielt, vorgeführt. musik wird gesprochen – das ist wunderbar! würden sie zwischen musik spielen und musik sprechen eine grenze ziehen? nein. alles fließt. [...]
josef anton riedl im gespräch mit michael lentz (MusikTexte 61)
„über zwanzig jahre lang habe ich artikel geschrieben und vorträge gehalten. viele waren in ihrer form ungewöhnlich – das gilt besonders für die vorträge – da ich hier analoge kompositionsprinzipien wie auf dem gebiet der musik angewendet habe. meine absicht war dabei oft, das, was ich zu sagen hatte, so zu sagen, daß es anschaulich wurde; dadurch würde es begreiflicherweise dem zuhörer eher möglich sein, zu erfahren, was ich zu sagen hatte, als wenn er nur darüber etwas hörte. [...]
so hielt ich auch um 1949 meinen „vortrag über nichts“. [...] dieser „vortrag über nichts“ ist in der gleichen rhythmischen struktur geschrieben, die ich damals in meinen musikalischen kompositionen anwandte. [...]
john cage: vorwort zu "silence" (übersetzung: ernst jandl)
also lieder. darin sollen text und musik keine getrennten künste sein, sondern sprache als klang, und mehr noch: blablabor entschlüsselt die sprache als sternenklaren singsang. es ist ein destillat aus dem wort selber. es macht das wort singend.
blablabor: "das liedlied"
komprimiert ist in einem wort, was sich über jahrhunderte an bedeutungs- und klangverschiebungen sedimentiert hat, was inzwischen in varietäten verschiedener sprachen und dialekte aufgegangen ist. wird ein wort dekomprimiert, öffnen sich explosiv welten. es zeigt sich ein universum an sinnzusammenhängen und klangskulpturen.
das wort wird sowohl semantisch als auch klanglich gedehnt; das wort bläht sich zum üppigen wortkörper auf. blablabor beleuchtet seine eingeweide; den grossen wortschatz und staunt …
blablabor: "das liedlied"
worte sind schatten. denn worte die das schweigen brechen, sind gegenstände. worte sind druckerschwärze, worte sind wellen, worte sind projektionen, worte sind taten, worte sind gestalten, worte haben formen. […] ich sage aber auch: worte sind spiele. spiele sind keine spielereien. spiele setzen lust, heiterkeit und bejahung voraus. wer worte als spiele erkennt, erkennt sie auch als schatten. […]
vergessen wir nicht, wie vielseitig, mehrdeutig, im fassbaren unfassbar worte sind. […]
eugen gomringer: "der dichter und das schweigen"
[…] ich lese verse, die nichts weniger vorhaben als: auf die konventionelle sprache zu verzichten, (sie) ad acta zu legen. […] ich will keine worte, die andere erfunden haben. alle worte haben andere erfunden. ich will meinen eigenen unfug, meinen eigenen rhythmus und vokale und konsonanten dazu, die ihm entsprechen, die von mir selbst sind. […]
da kann man nun so recht sehen, wie die artikulierte sprache entsteht. ich lasse die vokale kobolzen. ich lasse die laute ganz einfach fallen, etwa wie eine katze miaut… worte tauchen auf, schultern von worten; beine, arme, hände von worten. au, oi, uh. man sollte nicht zuviel worte aufkommen lassen. […] ich wollte die sprache hier selber fallen lassen. […] das wort will ich haben, wo es aufhört und wo es anfängt. dada ist das herz der worte.
jede sache hat ihr wort, aber das wort ist eine sache für sich geworden. warum soll ich es nicht finden? […] das wort, das wort außerhalb eurer sphäre, eurer stickluft, dieser lächerlichen impotenz, eurer stupenden selbstzufriedenheit, außerhalb dieser nachrednerschaft, eurer offensichtlichen beschränktheit. das wort, meine herren, das wort ist eine öffentliche angelegenheit ersten ranges. […]
hugo ball: "das erste dadaistische manifest"
jedes wort strömt wächst ist organ des folgenden wortes
carlfriedrich claus 1957/58
wörter wortkörper verbindungen von wörtern verbindungen von wörtern und wortkörpern verbindungen von wortkörpern
wörter wie sätze wörter zum kauen wörter zum verdrehen buchstäbliche wörter wortverhältnisse wortehen wortfamilien wortbetriebe wortmaschinen wortbazillen wortelefanten keine urworte orpheus ohne leier leierworte luminalwörter
[…]
franz mon in: poetische texte 1951 – 1970 s.124
worttaktik 1
wörter gebügelt, umgeboxt, aus vielerlei windungen gerade gebogen, ins licht gerückt, wenn einer sich bückt. in der backentasche vergessen. kein stromstoß, kein malstrom unter der zunge. zurechtgeschnitten mit der blechschere, unregelmäßige krümmungen aus kleinsten geraden mit scharfschartigem rand.
franz mon in: poetische texte 1971 – 1982 s. 91
mit dem terminus ‚auditive poesie‘ – in entsprechung zur ‚visuellen poesie‘ – bezeichne ich als übergeordneten sammelbegriff alle jene poetischen produkte, in denen sprachklang und artikulation bewusst mitkomponiert wurden, konstitutionierende bestandteile des textes sind.
gerhard rühm: vorwort zu „botschaft an die zukunft“
[...] wie ich es sehe, ist poesie einfach deshalb nicht prosa, weil poesie auf die eine oder andere art formgebunden ist. sie ist nicht poesie aufgrund ihres inhaltes oder ihrer mehrdeutigkeit, sondern weil sie erlaubt, in die welt des wortes musikalische elemente (zeit, klang) hineinzunehmen. so gibt es traditionen, durch poesie informationen zu übermitteln, und sei diese noch so trocken (z.b. die sutras und shastas indiens). auf diese weise war sie leichter zu erfassen. karl shapiro mag ähnlich gedacht haben, als er seinen „essay über den reim“ in gedichtform schrieb. [...]
john cage: vorwort zu "silence" (übersetzung: ernst jandl)
ich meine, ein auditiver text muss über den mitkomponierten sprachklang hinaus eine information vermitteln, die überhaupt erst durch die akustische realisation des textes, sofern man hier nicht schon von einer partitur sprechen will, rezipierbar wird. das einfache wort „du“ zum beispiel lässt sich durch verschiedene artikulation differenzieren, in seiner bedeutung verändern, je nachdem, ob es fragend, hinweisend, befehlend, zornig, zärtlich, erstaunt usw. ausgesprochen wird. diese differenzierungen sind solche des stimmklangs, des stimmausdrucks; es sind die musikalischen parameter der gesprochenen sprache wie lautstärke, klangfarbe, tonhöhe, tempo. der musikalische ausdrucksgestus der sprache vermittelt sich im emotionalen bereich so stark, dass es bereits auf dieser ebene […] zu einer durchaus sprachlichen wenn auch nonverbalen kommunikation kommen kann – und das um so unmissverständlicher, je emotionaler die inhalte sind, die mitgeteilt werden sollen.
die reine lautdichtung, jene dichtung also, die vokale äusserungen nicht mehr in begrenzten und, wo es sich nicht um onomatopoetische handelt, willkürlichen kombinationen verwendet, in denen sie begriffe bezeichnen, setzt nicht zuletzt bei diesem ausdrucksgestus der sprache an.
gerhard rühm: vorwort zu „botschaft an die zukunft“
was verstehen sie unter einem lautgedicht? ... für mich ist die neutralität des begriffs „laut“ sehr wichtig in meiner arbeit. also ein laut ist ein tierlaut, ist ein laut überhaupt in der natur oder auch ein industrielaut sogar, oder auch ein sprachlaut. und „gedicht“ ist eine knappe form, eine art konzentrat, mich besonders intensiv ausdrücken zu können mit solchen lauten. [...]
josef anton riedl im gespräch mit michael lentz (MusikTexte 61)
eine linie, einen laut nicht nur sehen, hören, sondern auch riechen, schmecken, voll empfinden. und umgekehrt: linien und farben, oder konsonanten und vokale soweit durchsichtig machen, daß z.b. eine duftwesenheit darin wohnen kann. […]
carlfriedrich claus: notizen: „an will grohmann gerichtet“ 1954
der menschliche sprachlaut ist eine noch unmittelbarere, ursprünglichere ausdrucksform als die linie, die ja nur die spur einer geste ist. Jeder mensch bringt in verschiedenen emotionalen situationen unzählige differenzierteste laute hervor, die auch ganz unabhängig von ihren aufgesetzten begriffen, einfach als „musikalische“ ausdrucksgesten, unmittelbar „verständlich“ wirken; jeder kennt sie aus eigener erfahrung, und sie sind in allen sprachkulturen gleich. die menschlichen sprachlaute bilden ein internationales ausdrucks“vokabular“, das buchstäblich für sich selbst spricht. man kann aus diesen vielfältigen, weit über den jeweils von den nationalsprachen genutzten bereich hinaus sich anbietenden lauten künstlerische gebilde formen, man kann sie ver-dichten, vereinzeln, neu ordnen, man kann sie vervielfachen […]; sie bilden das unmittelbarste und menschlichste gestaltungsmaterial, mit dem der künstler arbeiten kann.
gerhard rühm: vorwort zu „botschaft an die zukunft“
[...] in der krone einer alten kiefer am strande von wyk auf föhr hörte ich schwitters jeden morgen seine lautsonate üben.
er zischte, sauste, zirpte, flötete, gurrte, buchstabierte.
es gelangen ihm übermenschliche, verführerische, sirenenhafte klänge, aus denen eine theorie entwickelt werden könnte ähnlich derjenigen der dodekaphoniker.
hans arp: franz müllers drahtfrühling, erinnerungen an kurt schwitters
wie ich gesagt habe, ist jeder laut der von der menschlichen stimme hervorgebracht wird bedeutungsvoll – worte oder nichtworte, seien sie auf normative weise syntaktisch oder nicht. alle worte in gedichten sind bedeutungsvoll, ob sie vorsätzlich botschaften vermitteln oder nicht, und ob sie absichtlich in die gedichte gebracht worden sind oder nicht. die rezipienten inszenieren [...] bedeutungen, ob die dichter bedeutungen übermitteln wollen oder nicht.
jackson mac low im gespräch mit nicholas zurbrugg (MusikTexte 49)
unmittelbar an der artikulationsschwelle, wahrnehmbar in genauen, kauenden bewegen der sprechorgane, liegt die schicht von <kernworten>, die diesseits der bildhaftigkeit schon unter die haut gehen. erotisches und vorerotisch elementares ist darin konkret, wörter sind reizgestalten einer wirklichkeit, die wir oft nur mit ihrer hilfe zu erreichen vermögen, erschreckend, heiter, wüst oder wie sonst auch, - nicht <innen>, nicht außen sondern der geträumten vergleichbar aus körperlichkeit und einbildung zugleich erstellt und darum unüberbietbar real, der geträumten ungleich jedoch uns frei verfügbar. aus den konkreten formen der vokabelabläufe, der artikulationsgebärden stellt sich die welt als unsere eigenwelt her. sprechen unmittelbar an der artikulationsachse ist tanz der lippen, zunge, zähne; artikuliert, also prägnante bewegung; vokabeln die grundfiguren des tanzes, führen zwar die bedeutungen, beziehungen, bildschatten mit, doch in einem bewegungscharakter verschliffen, der seine richtungen aus sich selbst gewinnt.
sprechen, das sich zur poesie umkehrt, ist ein versuch, des selbstverständlichsten, das unter den komplizierten und aufreibenden arbeiten der sprache vergessen wurde, habhaft zu werden. poesie geht nicht darin auf, aber sie fahndet danach. sie braucht die primitive materiale erfahrung. sie kann dem elementaren gar nicht ausweichen, denn früher als das sprechen übten die lippen, zunge, zähne die tätigkeit des einverleibens, des zerstörens, des liebens, der lust. sie sind von diesen erfahrungen besetzt, wenn sie sich zum sprechen bilden; unvermeidlich werden sich die sprechgesten mit den charakteren jener tätigkeiten mischen, kreuzen, sich dran unterrichten und steigern. sie werden feinere versuche des zerreißens machen; sie nehmen dazu die flüchtigste speise, die luft, quetschen, stoßen, saugen sie, um die elementare gestik zu erforschen, von der die welt voll ist. wir sind hier hund, schwein, stier und hahn; wir mischen uns in ihre charaktere, wenn die sprache mit ihnen zu tun hat, zerreißen die bekannten erscheinungen und stoßen auf elastisches, finsteres, leuchtend durchlässiges gewebe, schwellungen, tönende dehnungen, rasselnde skelettformen, tiere, die es sonst nirgends gibt.
franz mon in: poetische texte 1951 – 1970 s.24
[…] ist ein stoß ist ein luftstoß ist ein satz ist ein zittern ist wachs ist nichts ist schwärzlich ist weiß ist lautlos ist leer ist leicht ist papier ist ein fleck ist ein satz [...] ist warm ist ein körper ist ein stoß ist luft ist ein zittern ist laut ist ein wort ist gefältelt ist sichtbar ist leicht […]
franz mon in: poetische texte 1951 – 1970 s.103
morphologie des hauchs:
hauchkern hauchfunktion hauchrand
sprechorganologie
ich milieu stammesgeschichte
der kehlkopf der körper ist kehlkopf des lichts der natur jedes wort
[…]
carlfriedrich claus 1957/58
[…] also: die spezifische mit-schwingung verschiedener organe beim sprechen, ihr nicht nur echohaftes einwirken in die laute, die selbst wieder so etwas wie organe in atmosphärischen körpern sind, zu erfahren, darum dreht sich’s.
herausstellen der jedem laut eigentümlichen gestalt, gegen das allgemeine sinn-timbre, zerlegung der worte, kreisung in sich jedes lautes, d.h.: elimination des stimmungsnebels, der meist über einem satz oder gar einem ganzen gedicht lagert … […]
die sprech-organe zugleich wahrnehmungs-, hör-organe (überraschend ihr in-aktion-treten: <es> sagt dann dinge, die man nicht ahnte, geschweige wußte, […] etwas wie ein gespräch entsteht, aus lauter unbekannten, die sich hier, nur hier manifestieren: in diesem augenblicksraum; zwischen zwei kehlwelten.)
carlfriedrich claus: „die vibrationen im klangbilderaum“ movens 1960
beobachten wie ein wort fällt: ein kleines macht nur ein geräusch, und es liegt schon da, meist unbeschädigt. noch kleinere liegen immer schon so zufällig wie gefallen. größere scheinen zu steigen, während sie fallen. ein wahrhaftig großes aber braucht lange. es dreht sich wie eine flügeltür. du siehst sein schrägwerden, den seitlichen aufputz von torkeln oder sein andeutendes knicken, das du noch lange als flaggezeigen verstehst und erst später, viel später, wenn es längst schon zu spät ist, als hochmut vor dem fall. denn unterwegs hält es sich immer wieder in stellungen, die sich ewig nicht zu ändern scheinen, wie die der sonne oder die eines kranichs auf einem bein. und es nutzt diese zögerungen zur vorbereitung der nächsten lage, auch wenn es an dieser dann vorbeifällt. denn an haarfeinen rissen trennen sich schon die konsonanten voneinander und setzen die vokale frei, welche je nach herkunft und zustand des zerberstenden wortes einen beißenden oder betörenden oder betäubenden geruch verbreiten, indes die brocken der konsonanten nah und fern zu boden prasseln.
franz mon in: poetische texte 1971 – 1982 s. 132
[…] doch nicht nur das plastische element machte sie offenbar – auch licht und farbe. wie sie z.b. das wellende, gleitende l oder das große fernen umrundende n sprach und die konsonanten durchglitzerte mit dem lichten i, oder aus dem dunklen balkenwerk der konsonanten ein weiteres a erstrahlen ließ – diese durchleuchtung und farbgebung des plastischen war ein erlebnis. [...]
carlfriedrich claus: „antonia dietrich in annaberg“ 1954
worttaktik 4
ein o mit einem i anbohren in der erwartung, daß die luft entweicht mit einem geräusch, das sich mit hilfe verschiedener konsonanten bestimmen läßt als a) schlagen eines fischschwanzes auf einem feuchten hackbrett, b) kratzen eines fingernagels hinter dem ohr, c) scheuern von hautrillen über hautrillen, d) pfeifen durch eine zahnlücke, e) abwärtsbewegung eines scharfen messers, f) austritt von blut in luftleerer höhe, g) suggeln von lippen an einem plastikschlauch oder eine fingerspitze.
franz mon in: poetische texte 1971 – 1982 s.120
zwischen vortrag und dichtung ist streng zu unterscheiden. für den vortrag ist die dichtung nur material. dem vortrag ist es sogar gleichgütlig, ob sein material dichtung ist oder nicht.
kurt schwitters: "konsequente dichtung" in: das literarische werk bd. 5 s.191
warum sind ihre lautgedichte in traditioneller buchstabenverschriftung notiert? weil ich über die anordnungs- und leseweise von lauten wie sie in der literatur geschieht, musik machen und dadurch neues gewinnen will für die musik. [...]
josef anton riedl im gespräch mit michael lentz (MusikTexte 61)
die konsequente dichtung ist aus buchstaben gebaut. buchstaben haben keinen begriff. buchstaben an sich haben keinen klang, sie geben nur möglichkeiten zum klanglichen gewertet zu werden durch den vortragenden. das konsequente gedicht wertet buchstaben und buchstabengruppen gegeneinander.
kurt schwitters: "konsequente dichtung" in: das literarische werk bd. 5 s.191
lettern weniger als lettern viel mehr als lettern geläufige lettern denkbare lettern undenkbare lettern
lettern als punkte stellen flecken löcher knoten gerippe gerüste gerüchte verhaue verstecke vorräte für schlimme zeiten fallen füße vehikel vordermänner
es könnte ein o gewesen sein es könnte morgen sein es könnte so gewesen sein es muß von mir sein man müßte es essen können
schwarz und weiß schwarz auf weiß schwarz als weiß schwarz wie weiß weiß wie wer
franz mon in: poetische texte 1951 – 1970 s.134
staunend, in ehrfurcht bewegt man sich in der wunderwelt der sprache. und ich glaube, diese ehrfurcht vor dem material […] ist eine der grundlagen künstlerischen schaffens.
die worte steigen wie märchenhafte wolken aus dem dunklen schweigen und tropfen langsam zurück in das weben der stille.
der dichter verwebt in seinen gebilden das wort mit der stille – er versucht, aus dem schweigen und dem laut eine ganzheit zu gestalten, die ganzheit des kunstwerkes.
carlfriedrich claus: notizen: „an will grohmann gerichtet“ 1954
der dichter ist einer der ein schweigen bricht, um ein neues schweigen zu beschwören. […] seine sache sind worte. ein wort sagen, ein schweigen brechen – der dichter beginnt. […]
die worte des dichters kommen aus dem schweigen, das sie brechen. dieses schweigen begleitet sie. es ist der zwischenraum, der die worte enger miteinander verbindet als mancher redefluss. […]
eugen gomringer: "der dichter und das schweigen"
eine koordination der worte
ist nur
in dem netz
möglich
das das schweigen
ausspannt
carlfriedrich claus 1957/58
[…] was wir brauchen ist stille; aber was die stille will, ist, dass ich weiter rede.
[…] aber nun gibt es stille und die wörter erzeugen sie, helfen mit, diese stille zu erzeugen. ich hab nichts zu sagen und ich sage es und das ist poesie wie ich sie brauche. dieses stück zeit ist gegliedert. wir brauchen nicht diese stille zu fürchten. – wir könnten sie lieben.
john cage: "vortrag über nichts" (übersetzung: ernst jandl)
die sprache ist raumlos, aber sie wirkt im raum. raumlose sprache – wortdurchschwungener raum.
die sprache, die tönende sprache ist in der zeit. man kann von „naturzeithaftigkeit“ (gebser) sprechen, aber vielleicht auch von „sprachzeithaftigkeit“. – erst im gedruckten wort tritt die sprache in lose beziehung zum räumlichen. nur in „lose beziehung“ deshalb, weil im nacheinander (des lesens) auch die zeit mitspielt. die zeit kann vom wort bestimmt, umschlossen, geformt werden.
der dichter gestaltet in seinen arbeiten nicht nur die sprache, sondern auch die zeit. er wirkt im element der zeit. […]
der dichter „gestaltet“ die zeit, d.h., seine gebilde schweben in der zeit, wie die gebilde des bildhauers in den raum greifen.
und so, wie der bildhauer die zeit einbeziehen kann, so der dichter den raum. […]
carlfriedrich claus: notizen: „an will grohmann gerichtet“ 1954
entscheidende differenz zwischen musik als (primär) klingendem und sprache als (primär) bedeutendem ist der bezug zur zeit.
beim aufnehmen von sprache verläuft die zeit ruckartig, steht gewissermassen still, bis eine bedeutungseinheit sich ergibt und fasst diese dann in einer kompression der gegenwart zu einem „augenblick“ zusammen. im weiteren aber wird die zeit nicht gestaltet – sie ordnet sich dem fluss des sprechens unter. dass dabei schwankungen des tempos – deren amplitude sich aus dem zwang zum sinn ergeben – selber bedeutung tragen können, bleibt als sekundär, als quasi psychologische unterfütterung, der bewussten wahrnehmung eher entzogen.
musik dagegen „dauert“. die unterscheidung von länge und kürze, von regelmässig – unregelmässig, klang und pause, rhythmus und puls sind ihr wesentlich.
andreas stahl
aber: die sprache läßt sich nicht so leicht, so schematisch in eindeutige beziehung zur zeit und zum raume bringen. überall sind durchdringungen, unübersehbare hintergründe, und nicht faßbare zeitwogen, die plötzlich alle festen markierungen überspülen. manchmal kugeln sich humor-kobolde aus den wogen, bleiben ein weilchen im raume liegen, um einen schematikus heranzulocken, und um sich dann, wenn der festleger alles genau registriert hat, in eine rauschende lachwelle aufzulösen.
carlfriedrich claus: notizen: „an will grohmann gerichtet“ 1954